
Karen Briesen
Die Pflege von Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus
Ethische Konflikte der Diakonissen im Katharinenhof Großhennersdorf und ihre Relevanz für die heutige Pflegepraxis
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 1. Auflage 2025, 130 Seiten, 25,00 €, ISBN 978-3-86321-748-8
Thematik und Kontext
Welche Rolle und welche Aufgaben hatten Pflegefachpersonen im Nationalsozialismus? Leisteten sie Widerstand? Oder fügten sie sich den Nationalsozialisten nicht nur politisch, sondern auch durch Handlungen? Menschen mit Behinderungen sind unbeschreibliche Gräueltagen angetan worden. 1940, so beschreibt es die Autorin in der Einleitung des Buches, wurden 223 Bewohner aus den Katharinenhof Großhennersdorf deportiert. Nur 27 Menschen haben von allen ehemaligen Großhennersdorfer Heimbewohnern das dritte Reich überlebt. Grund genug für eine historische Aufarbeitung. Die Autorin formuliert ihr Forschungsinteresse durch die gegenwärtige politische Lage in Deutschland, die klare Standorte und ein aktives Handeln erfordert. Gleichzeitig ist die Rolle der Krankenpflege im Nationalsozialismus bis heute zu wenig thematisiert. Nur durch die Kenntnisse der Vergangenheit können Situationen in der Gegenwart verstanden und ein kritisches Berufsverständnis entwickelt werden, so die Zielsetzung. Am konkreten Beispiel werden Handlungsspielräume der Diakonissen im Alltag beschrieben. Die beruhigende Botschaft: Es kam zu Widerstand von Pflegefachpersonen.
Über die Autorin
Karen Briesen ist im Jahr 1969 geboren. Sie ist Pflegewissenschaftlerin, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Praxisanleiterin. Außerdem gilt sie als Expertin für evidenzbasierte Pflege. Der Transfer neuer Erkenntnisse der Pflegepraxis und die Weiterentwicklung des pflegehistorischen Diskurses sind ihr wichtige Anliegen.
Rahmen der Publikation
Das vorliegende Buch ist im Rahmen einer Abschlussarbeit (Bachelorstudiengang Pflege, Schwerpunkt Praxisentwicklung an der Evangelischen Hochschule Dresden) entstanden. Das vorliegende Buch stellt eine wissenschaftliche Abhandlung dar und beantwortet eine konkrete Forschungsfrage. Darüber hinaus bietet es Anlagen, die Einblicke in historische Dokumente bieten.
Überblick zum Aufbau und Gliederung des Buches
Insgesamt verfügt das Buch über acht Kapitel sowie verschiedene Unterkapitel. Da es sich um eine wissenschaftliche Abhandlung handelt, ist die Struktur klassisch wissenschaftlich, d.h. über eine Einleitung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion etc. Ein Anlagenverzeichnis zeigt ausgewählte Dokumente, die im Rahmen der Arbeit aufgezeigt werden.
Diskussion
Zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse beschreiben die Situation von Menschen mit Behinderungen, vor allem aus pflegewissenschaftlicher Sicht. Gleiches gilt für die Rolle von Pflegefachpersonen im Nationalsozialismus. Es ist eine gute Idee, dass dieses Buch gleich beide Desiderate annimmt und für Erkenntnisse sorgt.
Folgende wissenschaftliche Fragen werden im Rahmen der Methodik formuliert: Inwieweit zeigten Diakonissen im Katharinenhof in Großhennersdorf in der Zeit des Nationalsozialismus ambivalentes Verhalten in Bezug auf Konformität und Widerstand, und wie beeinflusste diese Ambivalenz ihr Handeln?
Nachdem ausführlich und prägnant zugleich in den Forschungskontext eingeführt wurde, beschreibt die Autorin die Methodik der durchgeführten Forschung. Sie beschreibt, dass sie eine Grounded-Theory-Studie durchgeführt habe. Allerdings nicht mit dem Ziel der Theoriegenerierung, sondern als Möglichkeit, historisches Datenmaterial zu kodieren und den Ansprüchen der qualitativen Forschung Rechnung zu tragen. Diese durchaus interessante Methode wird für den Geschmack des Rezensenten zu kurz beschrieben, sodass im Nebulösem verbleibt, wie, angelehnt an die Gedanken von Glaser und Strauss, historische Dokumente kodiert werden. Hier wäre eine gewisse Tiefe, vor allem im Hinblick auf dieses komplexe Thema im Rahmen eines Bachelorstudiums eine Bereicherung gewesen. Dem Vorwort kann entnommen werden, dass die betreuende Professorin von der durchgeführten Studie begeistert ist. Es ist davon auszugehen, dass die Autorin gut begleitet wurde oder andere Erfahrungen vorhanden waren.
Weiter wird der historische Kontext der Studie beschrieben. Es wird die Gründung der Diakonissen-Mutterhäuser als auch die Entwicklung der Kaiserswerther Verbandes und der Diakonie bis 1933 beschrieben. Es folgt die Darstellung der Diakonissen im Katharinenhof Großhennersdorf in einem eigenen Kapitel.
Das Ergebniskapitel gliedert sich anschaulich an der Forschungsfrage. Im Mittelpunkt steht die Ambivalenz der Diakonissen. Es fällt auf, dass das Ergebniskapitel mit 5 Seiten sehr kurz ist. Allerdings sind die Ergebnisse und neuen Erkenntnisse sehr spannend zu lesen und es ist deutlich zu merken, dass viel Arbeit hier eingeflossen ist.
Ein Vergleich zu anderen Publikationen kann nur schwer getroffen werden. Das Thema der Forschung in diesem speziellem Kontext gibt es kein zweites Mal. Es ist daher als Pionierarbeit zu betiteln.
Fazit
Eine Leseempfehlung für Theoretiker*innen als auch Praktiker*innen im erweiterten Feld der Eingliederungshilfe und/oder Pflegefachpersonen, die Menschen mit Behinderung versorgen. Das Buch regt zum Reflektieren über die Rolle und das Berufsverständnis an und zeigt auf, dass es sich lohnen kann, klare Haltung zu zeigen.
Eine Rezension von Dr. Roman Helbig
Nachlass von Agnes Karll zu Forschungszwecken der Universität Koblenz übergeben
 Der verschollen geglaubte Nachlass von Agnes Karll (1868 - 1927), einer zentralen Person der deutschen Pflegegeschichte, wurde anlässlich ihres 98. Todestags am 12. Februar 2025 von ihrer Urgroßnichte...
Der verschollen geglaubte Nachlass von Agnes Karll (1868 - 1927), einer zentralen Person der deutschen Pflegegeschichte, wurde anlässlich ihres 98. Todestags am 12. Februar 2025 von ihrer Urgroßnichte...
Event-Tipp: Tagung „Krankenpflege in Kriegs- und Friedenszeiten aus historischer Perspektive“
 Die Sektion Historische Pflegeforschung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) veranstaltet gemeinsam mit dem DRK Landesverband Sachsen e. V. und dem Zentrum für Forschung, Weit...
Die Sektion Historische Pflegeforschung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) veranstaltet gemeinsam mit dem DRK Landesverband Sachsen e. V. und dem Zentrum für Forschung, Weit...Event-Tipp: 4. Fachtagung Pflegegeschichte "Personalmangel in der Pflege und internationale Antworten"
 Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und die Fliedner-Kulturstiftung laden am 29. Oktober 2024 herzlich zum pflegehistorischen Fachtag „Personalmangel in der Pflege und internationale Antworten – En...
Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und die Fliedner-Kulturstiftung laden am 29. Oktober 2024 herzlich zum pflegehistorischen Fachtag „Personalmangel in der Pflege und internationale Antworten – En...Call for Papers: "Krankenpflege in Kriegs- und Friedenszeiten aus historischer Perspektive"
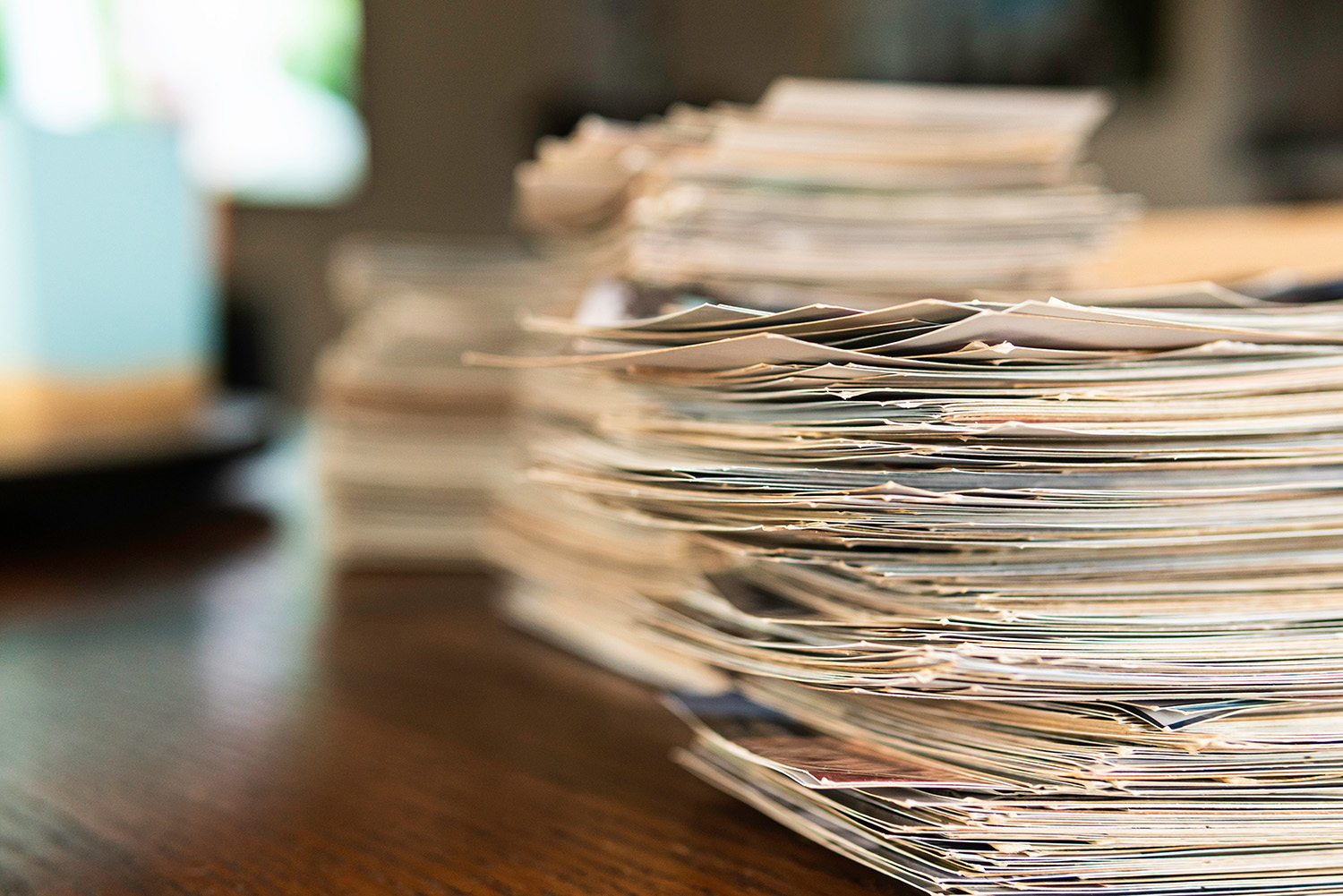 Die Sektion Historische Pflegeforschung (HPF) der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) und der DRK Landesverband Sachsen e. V. laden herzlich zur Teilnahme an einer Tagung anlässl...
Die Sektion Historische Pflegeforschung (HPF) der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) und der DRK Landesverband Sachsen e. V. laden herzlich zur Teilnahme an einer Tagung anlässl...
Sie möchten die Geschichte der Gesundheitsberufe abonnieren?
Erfahren Sie mehr zur historischen Entwicklung der Gesundheitsberufe & was wir aus der Vergangenheit für unser heutiges Berufsleben lernen können:




