![pflegepionierinnen in deutschland pflegewissenschaft]() Ingeborg Löser-Priester
Ingeborg Löser-Priester
Pflegepionierinnen in Deutschland
Zur Entwicklung der Pflegewissenschaft
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main 2021, broschiert, 282 Seiten, 39,95 €, ISBN 978-3-86321-442-5
In den letzten drei Jahrzehnten ist es gelungen, die Pflegewissenschaft in Deutschland breit im Hochschulsektor zu verankern: 2021 boten 58 Fachhochschulen, 14 Universitäten sowie sechs (Berufs-)Akademien und anderweitige Institute – 43 davon in staatlicher, 15 in kirchlicher und 20 in privatwirtschaftlicher Trägerschaft – ein Pflegestudium an. Das Angebot umfasst dabei insgesamt 149 Pflege-Studiengänge, davon 105 Bachelor und 44 Master. Eindeutig führend ist die Pflegewissenschaft, gefolgt von Pflegemanagement und Pflegepädagogik, die durch spezialisierte Pflege-Studiengänge, wie etwa Advanced Nursing Practice oder Palliativpflege, ergänzt werden.
Wenngleich die Entwicklung hierzulande im internationalen Vergleich, insbesondere gegenüber den USA, aber auch den angelsächsischen und skandinavischen Ländern lange Zeit hinterherhinkte, gab es erste Bemühungen einer Akademisierung der Krankenpflege in Deutschland bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Entsprechende Initiativen von verschiedenen Protagonistinnen der frühen Frauenbewegung wurden jedoch unter anderem durch den Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) auf Jahrzehnte hin abgedrängt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 – 1945) konnte die Entwicklung der Pflegewissenschaft und die damit verbundene Akademisierung der Pflegeberufe vor allem durch Einzelinitiativen vorangetrieben werden, die auf einen hohen persönlichen Einsatz einzelner Frauen zurückzuführen sind. Ihre beruflichen Lebenswege stehen im Zentrum des vorliegenden Buches der Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe und Dipl.-Soziologin Prof. Dr. phil. Ingeborg Löser-Priester (Jahrgang 1959), die am Fachbereich IV (Sozial- und Gesundheitswesen) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen den dualen Bachelorstudiengang Pflege leitet. Zu Wort kommen darin einige Pflegepionierinnen, die von ihrem beruflichen Werdegang sowie ihren Herausforderungen und Erfahrungen beim Aufbau und der Institutionalisierung der Pflegewissenschaft berichten.
Die Autorin, die nach ihrer Diplomarbeit zum Thema „Pflege studieren. Der Akademisierungsprozess in den Pflegeberufen am Beispiel hessischer Pflegestudiengänge“ (Frankfurt am Main 1995) 2001 an der Universität Frankfurt mit einer Arbeit über die „Privatisierung öffentlicher Krankenhäuser und Partizipation der Beschäftigten. Eine Fallstudie zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes“ (Frankfurt am Main 2003) promovierte, veröffentlichte neben diversen Zeitschriftenbeiträgen unter anderem auch (gemeinsam mit Klaus Priester) das Buch „Gesundheits- und Pflegeforschung – von der Idee zum Forschungsbericht. Ein Leitfaden für Studium und Praxis“ (Frankfurt am Main 2005).
Wie Ingeborg Löser-Priester einleitend schreibt, versteht sie unter Pflegepionierinnen „Wegbereiterinnen und Professorinnen der Pflegewissenschaft […], welche in Deutschland erste Voraussetzungen für die Pflegewissenschaft entwickelt sowie die ersten Pflegestudiengänge eingerichtet und geprägt haben“ (S. 12). Mit ihrem Engagement hätten sie „wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung der Pflegewissenschaft und die Verankerung der Disziplin im Hochschulsektor“ geschaffen. In der Folge habe in der Pflege eine stärker wissenschaftlich orientierte Diskussion eingesetzt, die durch erste (außeruniversitäre) Forschungsprojekte und die Rezeption von Pflegetheorien aus dem angloamerikanischen Raum verstärkt worden sei.
Nach der Einleitung gliedert sich die Darstellung in zwei Teile. Während im ersten Teil (S. 17 – 53) in drei Kapiteln die Anfänge der Entwicklung der Pflegewissenschaft und Akademisierung der Pflegeberufe – konkret wegbereitende Initiativen und (Modell-)Projekte im Bildungsbereich der Pflege (1950er bis 1980er Jahre), wegbereitende Initiativen und Projekte in der Pflegeforschung (1970er bis 1980er Jahre) und der Aufbau akademischer Strukturen für die Pflege seit Ende der 1980er Jahre – skizziert werden, stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils (S. 55 – 266), der wesentlich umfangreicher ist, die beruflichen Lebenswege ausgewählter Pflegepionierinnen und ihre persönlichen Erfahrungen mit der Entwicklung der Pflegewissenschaft. Die entsprechenden Personen – im Einzelnen handelt es sich hierbei um Renate Reimann, Gerda Kaufmann, Prof. Dr. Ruth Schröck, Prof. Dr. Sabine Bartholomeyczik, Prof. Monika Krohwinkel, Prof. Christel Bienstein und Prof. Dr. Hilde Steppe (1947 – 1999) – wählte die Autorin „aufgrund ihres Bekanntheitsgrades und ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Pflegewissenschaft und Akademisierung der Pflegeberufe.“ Eine Auswahl habe aufgrund der Handhabbarkeit des Vorhabens getroffen werden müssen, was unvermeidbar zum Ausschluss anderer an der Entwicklung der Pflegewissenschaft beteiligten Personen geführt habe. Diese fänden allerdings zum Teil Erwähnung und Würdigung durch die Pionierinnen selbst in den Interviews und im ersten Teil des Buches.
Die einzelnen Erzählungen steuerte Ingeborg Löser-Priester durch „Themenkreise“, die sie in einem Leitfaden vorab festgelegt hatte. Auf diese Weise schildern die vorgestellten Pflegepionierinnen ihren beruflichen Lebensweg vom Ende der Schulzeit, der Ausbildung zur Krankenschwester bis zur Professur beziehungsweise der letzten beruflichen Position. Sodann berichten sie von ihren Erfahrungen mit dem Aufbau der Pflegewissenschaft in Deutschland und der Implementierung im etablierten Wissenschaftsbetrieb, ebenso wie vom Umgang mit Spannungsfeldern. Weitere Schwerpunkte der Erzählungen bilden die Bedeutung der Pflegewissenschaft für die Weiterentwicklung einer professionellen pflegerischen Praxis, Erfahrungen mit berufspolitischer beziehungsweise gewerkschaftlicher Arbeit sowie die Auswirkungen des beruflichen Engagements auf das Privatleben. Ergänzt werden die Interviews jeweils durch tabellarische Lebensläufe mit Angaben zu Ausbildung, Beschäftigungsverhältnissen, Lehr- und Forschungsschwerpunkten, Politikberatung und weiteren Funktionen, die eine schnelle Orientierung zu Leben und Werk der zu Wort kommenden Personen erlauben.
In ihrer „Würdigung“ (S. 268 – 273) am Ende des zweiten Teils weist die Autorin darauf hin, dass alle Pflegepionierinnen hinsichtlich ihrer Qualifizierung – für die damalige Zeit eine Besonderheit – nach der Ausbildung ein Pflegestudium / eine akademische Qualifizierung im Ausland oder ein sozialwissenschaftliches Studium in Deutschland absolvierten und akademische Grade erwarben. Wörtlich hält sie hierzu weiter fest: „Sie waren aufgeschlossen gegenüber Veränderungen und bereit, Unsicherheiten, Anstrengungen, Entbehrungen und zum Teil erhebliche finanzielle Belastungen in Kauf zu nehmen. Mit pflegewissenschaftlichem Wissen und neu erworbenen Kompetenzen ausgestattet kehrten sie nach Deutschland zurück. Überwiegend als Einzelvertreterinnen eines neuen Denkens in der Pflege lösten sie hier innovative Aktivitäten und Projekte in der Pflegepraxis, in der Pflegebildung und im Pflegemanagement aus“ (S. 269).
Die Pflegepionierinnen hätten sich zu „Trägerinnen einer Modernisierung der Pflege“ entwickelt, wobei es ihnen gelungen sei, die historischen Wurzeln der Pflege im Auge behaltend, das Neue einzuleiten: „Sie stellten tradierte Rollenerwartungen des Pflegeberufs und die Abhängigkeit von der patriarchal geführten Medizin zunehmend infrage. Sie waren Trägerinnen eines neuen Selbstverständnisses, indem sie darauf hinwiesen, dass Pflege eigenständige Inhalte besitzt und nicht zentral aus medizinischen Krankheitssymptomen abgeleitet werden kann“ (S. 270). Der eigenständige therapeutische Beitrag der Pflege zur Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen und ihrer Bezugspersonen sei damit in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Zentrale Bestandteile des Engagements der Pflegepionierinnen sei die Verbindung von Unterrichtstätigkeit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Pflegeberufen mit der Nähe zur beruflichen Praxis, Pflegewissenschaft und -forschung sowie Berufspolitik gewesen. Sie hätten ihre Lehr- und Leitungsfunktionen genutzt, um das neu gewonnene Pflegeverständnis in die Praxis hineinzutragen und die Qualität der pflegerischen Versorgung gemeinsam mit den Pflegenden zu verbessern, wobei sie Änderungen teils gegen Widerstände von Ärzt*innen und/oder Pflegenden durchsetzen mussten.
Ergänzt wird die Darstellung, die von den vorgestellten Pflegepionierinnen jeweils auch eine Portraitaufnahme in schwarz-weiß enthält, durch Literaturangaben (S. 275 – 282), wodurch eine Weiterbeschäftigung mit dem Thema leicht möglich ist.
Unterdessen wurde im Text auf einen Anmerkungsapparat weitgehend verzichtet. Weiterführende Hinweise finden sich lediglich zu Begriffsklärungen, wie beispielsweise zur FDJ (Freie Deutsche Jugend) oder zum SGB V (Sozialgesetzbuch V), einigen im Text erwähnten Personen der Zeitgeschichte, wie etwa Rudi Dutschke (1940 – 1979) und Klaus von Dohnanyi (*1928), sowie diversen Medizinern und Hochschullehrern, darunter Klaus Dörner (*1933) und Peter F. Matthiessen (1944 – 2019). Zu den erwähnten Pflegewissenschaftler*innen gibt es hingegen nur in Einzelfällen Anmerkungen, wobei diese sich auf Internetangaben und in einem Fall – einer bereits verstorbenen Person – auf das „Who is Who in der Pflege“ (Bern 1999) beschränken. Hier hätte man sich zu allen im Text erwähnten, für die Pflegewissenschaft relevanten Personen – namentlich Dirk Axmacher (1944 – 1992), Georg Evers (1950 – 2003), Antje Grauhan (1930 – 2010), Virginia Henderson (1897 – 1996), Agnes Karll (1868 – 1927), Olga von Lersner (1897 – 1978), Martha Meier (1930 – 2016), Martin Mendelsohn (1960 – 1930), Florence Nightingale (1820 – 1910), Adelaide Nutting (1858 – 1948), Dorothea Orem (1914 – 2007), Hildegard Peplau (1909 – 1999), Maria Pinding (1932 – 1990), Martha Rogers (1914 – 1994), Anna Sticker (1902 – 1995), Hilde Steppe (1947 – 1999), Johanna Taubert (1946 – 2008), Clementine von Wallmenich (1849 – 1908) und Otto Werner (1847 – 1923) – weiterführende Angaben auf das bisher im Umfang von neun Bänden vorliegende „Biographische Lexikon zur Pflegegeschichte. Who was who in nursing history“ umso mehr gewünscht, als die historische Pflegeforschung in Deutschland nach wie vor ein Schattendasein führt und im Akademisierungsprozess der Pflege – ein entsprechender Lehrstuhl ist weiterhin nicht in Sicht – scheinbar vollkommen vergessen wurde.
Sieht man hiervon einmal ab, bietet das kurzweilig zu lesende Buch „Pflegepionierinnen in Deutschland“ einen überaus authentischen Einblick in die Anfänge der Pflegewissenschaft und damit einer akademischen Disziplin, die aus der heutigen Hochschullandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Die Veröffentlichung von Ingeborg Löser-Priester ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Pflegewissenschaft, sondern auch – als zeithistorisches Ergo-Dokument – eine außerordentlich bedeutende Quelle für Pflegehistoriker*innen in späteren Zeiten.
Eine Rezension von Dr. Hubert Kolling


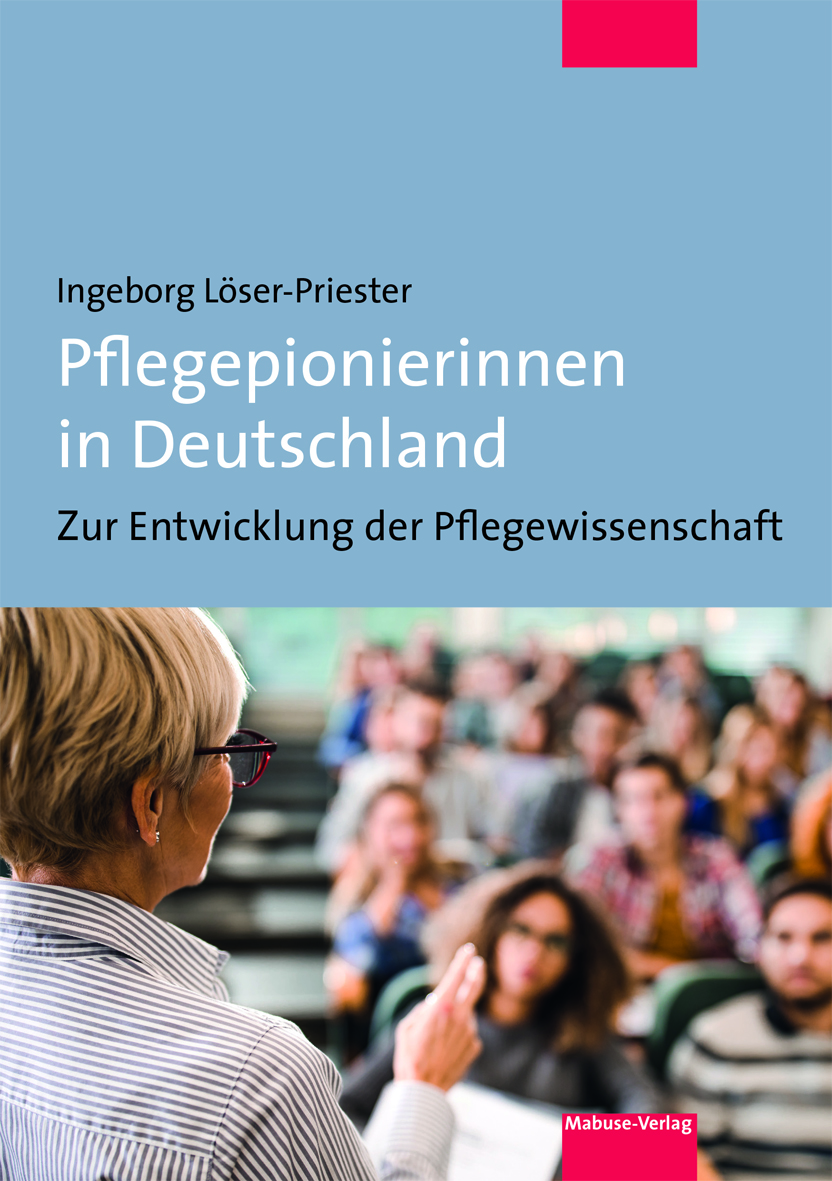 Ingeborg Löser-Priester
Ingeborg Löser-Priester Regula Schär
Regula Schär Marion Baschin (Hrsg.)
Marion Baschin (Hrsg.)