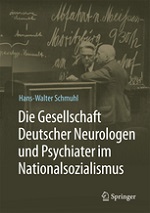
Schmuhl, Hans-Walter (Hrsg.)
Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Nationalsozialismus
Springer, Berlin-Heidelberg, 2016, XIII und 457 S., 39,99 €, ISBN 978-3-662-48743-3
Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Nationalsozialismus
Springer, Berlin-Heidelberg, 2016, XIII und 457 S., 39,99 €, ISBN 978-3-662-48743-3
Die 1935 aus Vorgängerverbänden entstandene Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater repräsentierte angesehene, teilweise auch nach Kriegsende prominent tätige Mediziner. Vertreter dieser Fachgesellschaft stellten sich und ihre Vereinigung in den Dienst der nationalsozialistischen Biopolitik. Das vorliegende Werk stellt die Aktivitäten der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater während der NS-Zeit und ihr Fortwirken in der jungen Bundesrepublik quellengestützt dar.
Der Historiker Hans-Walter Schmuhl (apl. Prof. der Universität Bielefeld) zeichnet als Autor für die Monographie verantwortlich, welche den Abschlussbericht für einen Forschungsauftrag der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) darstellt.
Das Forschungsprojekt kann sich dabei auf Vorarbeiten stützen, die auf einem Beschluss der DGPNN-Mitgliederversammlung von 2009 fußen. Die systematische Aufarbeitung der Geschichte der Vorläufergesellschaften begann mit der Einsetzung einer unabhängigen internationalen Kommission von Historikern durch den Vorstand. Die Kommission begleitete die durch die DGPPN finanzierten und initiierten Forschungsaufträge. Die ausgeschriebenen Mittel für ein zweijähriges Forschungsprojekt wurden an Hans-Werner Schmuhl zur Erforschung der Geschichte der psychiatrischen Fachgesellschaften und an Rakefet Zalashik zur Anschubfinanzierung eines Projektes betreffend die erzwungene Migration jüdischer Psychiater vergeben. Die vorliegende Monographie bildet einen Ertrag dieser Forschungen, welche sich auf umfangreiches, teilweise auch aus den National Archives Washington und aus Privatbesitz entnommenes Quellenmaterial stützen. Daneben sind im Rahmen der Kommissionsarbeit Aufsätze und ein Sammelband über psychiatrische Therapien entstanden. (S. V-IX)
Das Werk gliedert sich in fünf Hauptteile (A-E) und einen Anhang (mit Mitgliederverzeichnis des Deutschen Verbandes für psychische Hygiene, Quellen und Literatur sowie einem Personenregister).
Die Einleitung (A, S. 1-22) enthält einen Überblick über den Forschungsstand betreffend die wissenschaftlichen Fachgesellschaften im Nationalsozialismus, konzeptionelle Vorüberlegungen zum Verhältnis Wissenschaft und Politik sowie methodologische Vorüberlegungen, wobei man sich auf netzwerkanalytische Überlegungen bezieht. Als erkenntnisleitende Fragestellungen werden die Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik, der Ressourcenaustausch zwischen Akteuren der beiden Sphären sowie Allianzen und deren Folgen benannt (S. 20). Die Einleitung schließt ab mit Angaben zum Aufbau der Arbeit und redaktionellen Hinweisen (S. 21 f.).
In Teil B (S. 23-132) wird die Vor- und Gründungsgeschichte der Gesellschaft Deutscher Psychiater und Neurologen abgehandelt. Die psychiatrisch-neurologischen Fachgesellschaften in Deutschland werden bis 1933 in ihren je eigenständigen Entwicklungen dargestellt und verschiedene Phasen mit ihren Akteuren und Entwicklungen näher ausgeführt: Netzwerke und Interessengruppen, welche die Gleichschaltung entweder forcierten oder zu verschleppen versuchten, werden vorgestellt; es wird aufgezeigt, wie sie auf die Fachgesellschaften und deren Ausrichtung im Rahmen der Verbandsarbeit und der Satzungsdiskussionen einzuwirken versuchten.
Die Zusammenführung der unterschiedlichen Fachgesellschaften zur Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater erfolgte nicht organisch, sondern nach einem 2-jährigen Ringen. 1935 gegründet, befand sie sich bis 1939 in einer Phase der inneren und äußeren Konsolidierung, in der das Verhältnis zu den jüdischen und ausländischen Mitgliedern sowie zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen, insbesondere den Internisten und den Psychotherapeuten, und (Regional-)Gruppen innerhalb und außerhalb der Gesellschaft geklärt werden musste. Mit der Annäherung der Wissenschaft an die Politik des Nationalsozialismus wurde auch der Beitrag der in der Fachgesellschaft organisierten Wissenschaften zur Biopolitik zum Thema. Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater unterstützte neuartige Therapien; sie beriet die Politik betreffend die Erbbiologie und Rassenhygiene und pflegte diese bereits vor der NS-Zeit beforschte Thematik auch im Rahmen ihrer Fortbildungstätigkeit, in ihren Publikationen und im internationalen Fachdiskurs. So wurde sie gleichsam zu einer Clearing-Stelle zwischen praktischer Psychiatrie, Wissenschaft und Biopolitik (Teil C, S. 133-270).
Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Zweiten Weltkrieg (Teil D, S. 271-394) bewegte sich im Spannungsfeld zwischen aktiver Unterstützung der „Aktion T 4“ durch prominente Mitglieder der Fachgesellschaft und einzelnen Netzwerken gegen die Euthanasie (vorgestellt an vier Fallbeispielen). Schlüsselfigur in der „Aktion T 4“ wurde Paul Nitsche, welcher dadurch auch Einfluss im Verband gewann. Der Widerstand gegen das Euthanasie-Programm bewegte sich zwischen gesinnungsethischer Verweigerung bis zur verantwortungsethisch begründeten Mitwirkung, blieb aber insgesamt eher passiv. Er unterschied sich auch je nach beruflicher Stellung des jeweiligen Akteurs und der dadurch gegebenen Möglichkeiten. Mit dem Verweis auf die notwendige ethische Haltung der Krankenpflege wurde etwa von Hermann Grimme die Ablehnung begründet (S. 330). Die Sechste Jahresversammlung fand trotz entsprechender Planungen nicht mehr statt. In den letzten Kriegsjahren veränderten sich die Aktivitäten der Fachgesellschaft: neue Forschungsschwerpunkt wurden nötig; gleichzeitig versuchte man die Leistungen der Psychiatrie seit 1933 zu würdigen und mit Anregungen zu deren Weiterentwicklung die durch die Euthanasie entstandene Legitimationskrise zu überwinden.
Unter „Zusammenfassung und Ausblick“ (Teil E) wird auf S. 395-416 die Entwicklung der Fachgesellschaft mit den Paradigmen von Organisation-Netzwerk analysiert und deren Weiterwirken in der jungen Bundesrepublik angerissen. Bei grundsätzlicher personeller Kontinuität blieben Erbgesundheit und Politikberatung Gegenstand der Nachkriegsaktivitäten. Von der NS-Euthanasie und der eigenen Verstrickung distanzierte man sich auf dem V. Internationalen Neurologenkongress 1953 mit der Begründung, es sei damals unmöglich gewesen, dieser Meinung offiziell Ausdruck zu geben (S. 415).
Die vorliegende Monographie leistet eine umfassende, auf reiches Quellenmaterial gestützte Aufarbeitung der Geschichte der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Nationalsozialismus und in der jungen Bundesrepublik. Sie zeigt die tiefen Verstrickungen führender Fachvertreter und Vorstandsmitglieder in die nationalsozialistische Biopolitik und ihre Ziele. Sie macht deutlich, dass über psychiatrische Genetik, Rassenhygiene und Eugenik bereits vor 1933 Anschlussfähigkeit vor allem der Psychiatrie an die nationalsozialistische Ideologie bestand. Die einschlägigen Fachgesellschaften wurden durch den Nationalsozialismus nicht „feindlich übernommen“; dem Nationalsozialismus gegenüber aufgeschlossene Akteure gelangten in einem Anpassungsprozess in Schlüsselstellungen und stellten sich freiwillig in den Dienst der Politik. Die Ausdifferenzierung der wissenschaftlichen Disziplinen und deren Einbindung in den internationalen Diskurs ging dennoch weiter. Auch Forderungen nach Gleichstellung der „Irrenpflege“ mit dem übrigen Pflegepersonal wurden erhoben (S. 379). Gleichzeitig brach sich ein Absolutheitsanspruch der psychiatrischen Wissenschaft Bahn, mit dem sie sich auch die Sphäre des Rechts anzueignen versuchte (S. 285 ff.).
Das Werk ist übersichtlich nach Teilen, nummerierten Kapiteln und thematischen Unterpunkten, welche mit Stichworten oder Zitaten anschaulich eingeleitet werden, gegliedert und zitiert viele Quellen graphisch abgesetzt im Original. Druck und Fadenheftung der Hardcover-Ausgabe sind in sehr hoher Qualität ausgeführt. Kleinere Uneinheitlichkeiten im Druckbild (S. 71 f.) oder auch die m.E. unnötige Einbettung in die soziologische Organisations- und Netzwerktheorie (S. 16-20. 396-405) können an dieser Gesamtbeurteilung nichts ändern.
Die Forschungsergebnisse sind ausgesprochen lesenswert nicht nur für medizinhistorisch, sondern auch ethisch sowie berufs- und wissenschaftspolitisch Interessierte. Sie zeigen, wie organisierte Wissenschaft mit ihren spezifischen Interessen und Abhängigkeiten im Zusammenspiel mit Ideologie und politischer Macht einen Komplex bildet, der sich andere gesellschaftliche Sphären einzuverleiben sucht und damit die eigene Delegitimierung fördert.
Eine Rezension von Dipl.-Theol. Andrea Windisch B.Sc.

