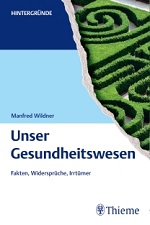
Wildner, M.
Unser Gesundheitswesen
Fakten, Widersprüche, Irrtümer
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2015, 192 S., 19,99 €, ISBN 978-3-13-176691-5
Unser Gesundheitswesen
Fakten, Widersprüche, Irrtümer
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2015, 192 S., 19,99 €, ISBN 978-3-13-176691-5
Rezension 1
Das Gesundheitswesen in den westlichen Industrieländern ist – bei allen Unterschieden – ein hochkomplexes System, das nicht nur für nicht in dieses System involvierte Betrachter meist nicht wirklich transparent ist. So nahm man das vorliegende Buch doch interessiert in die Hand; vor allem der Untertitel machte neugierig.
Der Autor ist Arzt mit Praxiserfahrung in Deutschland und im angelsächsischen Bereich sowie der Zusatzqualifikation in Public Health. Er leitet das Landesinstitut für Gesundheit am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht und ist Professor für Gesundheitspolitik und Gesundheitsverwaltung an der Universität München.
Wer nun das Buch in die Hand genommen hatte, um detaillierte Informationen über das Gesundheitswesen in Deutschland zu erhalten, wird bei der Lektüre der 22 nicht allzu langen Kapiteln enttäuscht. Es werden systematisch nicht zusammenhängende Themen abgehandelt wie „Der Weg zum ewigen Leben“ oder „Wie viele Ärzte braucht das Land? Eine falsch gestellte Frage“, die durchaus etwas mit dem Gesundheitswesen zu tun haben, aber auch solche, bei denen der Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen nicht ohne Weiteres erschließt, wie „Europa – Einheit in Vielfalt“ oder „Frieden auf Erden – die menschliche Schicksalsgemeinschaft“. Dabei gerät das eigentliche Thema des Buches im Verlauf des Buches immer mehr in den Hintergrund. Bei der Suche nach einer Erklärung für dieses Missverhältnis von Titel und Inhalt bzw. Erwartung und Vorgefundenem ist der letzte Satz des kurzen Textes, in dem der Autor vorgestellt wird, erhellend: Die Ausführungen beruhen auf den von dem Autor verfassten Editorials der Zeitschrift „Das Gesundheitswesen“.
Auch wenn man nicht wirklich viel Grundlegendes über die Struktur des deutschen Gesundheitswesens erfährt, ist die Lektüre der Kapitel (ohne Probleme auch einzeln) dennoch lohnend. Die Texte sind bis auf wenige Stellen, an denen die deutsche Grammatik missachtet wird, sehr gut lesbar, mitunter angereichert mit Anekdoten. Der Autor erweist sich als sehr belesen und hinsichtlich der historischen Herleitung von Gegebenheiten in unserer modernen Gesellschaft als ausgesprochen kenntnisreich.
Wenn schon nicht systematisch Fakten zum Gesundheitswesen dargestellt werden, wie der erste Untertitel des Buches insinuiert, so hätte es ja sein können, dass wenigstens Widersprüche – der zweite Untertitel – aufgezeigt würden, was ja auch einem Editorial einer wissenschaftlichen Zeitschrift überaus gut zu Gesichte stehen würde. Aber auch diesbezüglich wird der Leser leider enttäuscht. Es werden zwar durchaus Probleme angesprochen, aber die eigentlichen Anachronismen des Systems bleiben ausgespart – einige Beispiele:
- In dem Kapitel „Neues vom Übermenschen – Höchstleistungen der Medizin“ wird die Rolle des Arztes beleuchtet. Hier heißt es: „Die Selbst- und Fremdzuschreibung (der) ärztlichen Rollen ist dabei vielfältig. Sie umfassen die Rollen als Helfer und Beistand in kritischen Lebensphasen, als Kompetenzträger in körperlichen, seelischen und sozialen Nöten, als (bisweilen letzte) Hoffnungsträger.“ Auch wenn der Autor ergänzt, dass diese Rollenzuschreibung vielleicht mehr aus der Sicht der Leidenden als aus der des Arztes erfolgt, wäre in diesem Zusammenhang doch eine Erwägung darüber hilfreich, welche Bereiche der Medizin eigentlich erfolgreich sind – dass es eben nicht die Bereiche in der Nachfolge der klassischen Medizin sind, sondern die in der Nachfolge der Barbiere und Hufschmiede. Auch wäre hier aufzuzeigen, dass dem Arzt erst durch die zunehmende Bedeutungslosigkeit der gesellschaftlichen Institution Kirche und deren Vertreter die Rolle des seelischen Beistandes zukam. Schließlich wäre zu problematisieren, inwieweit Ärzte für diese Aufgabe überhaupt qualifiziert sind.
- Erwägungen zu Höchstleistungen der Medizin wären der rechte Ort, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Medizin sich von einer neuen Therapiemöglichkeit zur nächsten weiterentwickelt, sie aber über keinerlei Kriteriologie verfügt, unter welchen Bedingungen besser auf Therapieoptionen verzichtet werden sollte. Dass sich dafür offenkundig niemand interessiert, ist in vielen Bereichen, vor allem in Intensivstationen ein zentrales Problem.
- Im Kapitel „Wie viele Ärzte braucht das Land? Eine falsch gestellte Frage“ macht der Autor durchaus zutreffend auf den Umstand aufmerksam, dass es eigentlich genug ausgebildete Ärzte gibt und dass es durch die Leitungsverdichtung im klinischen Bereich dort zu einem höheren (auch) ärztlichen Personalbedarf kommt. Nicht erwähnt wird, dass durch die nicht gegebene Niederlassungsfreiheit viele altgediente Fachärzte in den Kliniken hängen bleiben, die eigentlich keine klinische Karriere im Sinn hatten.
- Die Kassenärztlichen Vereinigungen finden in diesem Kontext Erwähnung. Diese warnen vor nicht besetzten Arztstellen im ländlichen Bereich. Dass die KVs im Computerzeitalter per se einen regelrechten Anachronismus darstellen, bleibt unerwähnt – sie sind zum einen offenkundig nicht in der Lage, ihren gesetzlichen Auftrag einer flächendeckenden ärztlichen Versorgung zu erfüllen. Und ärztliche Leistungen mit dem Kostenträger abzurechnen, ist im Informationszeitalter ohne Probleme anders möglich. Schließlich wäre hinsichtlich der Honorare der ärztlichen Vertreter in den Gremien der KVs, die, freundlich gesprochen, einen Skandal darstellen, Transparenz herzustellen.
- An mehreren Stellen wird die in Deutschland etablierte, vorgeblich „solidarische“ Finanzierung des Gesundheitswesens erwähnt. Es wird dabei kein kritischer Gedanke darauf verschwendet, ob dieses System, das auf Bismarck zurückgeht und zu einer Zeit entwickelt wurde, als der Medizin so gut wie keine Handlungsmöglichkeiten zu Gebote standen, zur Finanzierung einer Milliarden schweren und profitorientierten Pharma- und Medizintechnikindustrie geeignet ist. Die in 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eingeführte Einzelleistungsabrechnung mit den damit zusammenhängenden Fehlanreizen wird nicht kritisch gewürdigt. Auch findet keine Erwähnung, dass die Familienmitversicherung eine (zu begrüßende) politische Entscheidung ist, woraus folgt, dass den gesetzlichen Krankenkassen die Beiträge für die mitversicherten Familienmitglieder aus Steuermitteln zu erstatten wären (ob der Steuermittelzuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung dies abdeckt, wäre zu prüfen). Schließlich gehörte hier eine kritische Würdigung des Nebeneinanders von gesetzlicher und privater Krankenversicherung hin – dies ist nun wahrlich ein Widerspruch in unserem Gesundheitssystem.
Die Liste der nicht erwähnten Widersprüche unseres Gesundheitsversorgungssystems ließe sich beliebig erweitern.
Das Buch ist gut zu lesen. Den im Titel angedeuteten Anspruch lösen die Ausführungen nicht ein. Auch wenn man bereit ist, einem Editorial eine gewisse Oberflächlichkeit zuzugestehen (bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift wäre etwas mehr Tiefgang allerdings auch nicht schädlich), kann dies für ein Buch nicht unbedingt gelten. Ob man es erwerben soll, mag offenbleiben. Wenn nun ein schwäbischer Verlag die Editorials einer bei ihm erscheinenden Zeitschrift als Buch zu vermarkten versucht, hat dies, freundlich gesprochen, auch ein “Gschmäckle“.
Eine Rezension von Paul-Werner Schreiner
Rezension 2
Das Buch aus der Reihe „Hintergründe“ des Thieme-Verlags will „Informationen für ein grundlegendes Verständnis für den Kontext“ geben, in dem die Bürger sich ein Urteil über das Gesundheitswesen bilden. Die Zielgruppe ist weit definiert, von Mitarbeitern im Gesundheitswesen bis zum interessierten Laien. Der Autor Manfred Wildner qualifiziert sich für diesen Rundumblick durch seine Erfahrung als Arzt in Deutschland, Großbritannien und den USA, sowie durch wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit. Er ist Leiter des Bayerischen Landesinstituts für Gesundheit und Schriftleiter der Zeitschrift „Das Gesundheitswesen“.
Den jeweils knapp zehnseitigen Beiträgen ist anzumerken, dass sie auf Editorials aus „Das Gesundheitswesen“ basieren. Sie stellen aus unterschiedlichen Blickwinkeln Facetten des Gesundheitssystems dar und enthalten Ansprachen des Publikums wie „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Finden Ihrer persönlichen Gesundheit!“. Den Ansatz kann man vielleicht am besten als launig-philosophisch bezeichnen. Dabei sind der Untertitel des Buchs wie auch der Klappentext („Warum sinkt die Zahl der Verkehrstoten, obwohl die Verkehrsdichte steigt? Welche Faktoren lassen die durchschnittliche Lebenserwartung um derzeit 3 Monate pro Kalenderjahr steigen?“) irreführend. Fragen wie die zitierten werden zwar auch beantwortet, aber eigentlich handelt es sich eher um sozialphilosophische Essays als um eine Sammlung von Hintergrundinformationen und Anekdoten, wie der Verlag nahelegt. Viele Überlegungen des Autors können durchaus nützliche Denkanstöße geben. Für diejenigen, die in ein Thema tiefer einsteigen wollen, gibt es am Ende jedes Kapitels einen Verweis auf etwa zehn wissenschaftliche (aber auch belletristische) Publikationen verschiedenster Disziplinen, die allerdings überwiegend Jahre bis Jahrzehnte alt sind. Wildner formuliert flüssig und anschaulich, seine Texte lesen sich trotz der Abhandlung komplexer Themen auf jeweils knappem Raum angenehm. Ein technisches Manko wird der Leser darin sehen, dass das Buch verlangt offengehalten zu werden: Der Rücken lässt sich nicht brechen.
In den meisten der Beiträge unternimmt der Autor zunächst einen Ausflug in die Kulturgeschichte. Diese Aufhänger sind mal weiter hergeholt, mal passender. In „Wie es Euch gefällt – Das mächtige Placebo“ steigt er zu Reflexionen über die Selbstheilungskräfte des Menschen mit einem Zitat aus Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ ein, um dann Begriff und Geschichte des Placebos zu erläutern. Wildner spricht sich dafür aus, an alle – auch alternativen – Heilverfahren dieselben wissenschaftlichen Maßstäbe anzulegen, und weist darauf hin, dass Placebos nur als gut begründete Abweichung von ethischen Grundsätzen eingesetzt werden können. Explizit um ethische Fragen geht es in mehreren Beiträgen. Im Gesundheitswesen haben wir es mit einer Pluralität von Ethiken zu tun, so der Autor, die jedoch auf einen Kern rekurrieren sollten, der die Würde des Menschen beinhaltet.
In „Nikomachos – eine Diskussion im Interesse unserer Kinder“ plädiert Wildner für eine Institutionen- und Ordnungsethik, um Chancengleichheit bei knappen Ressourcen zu sichern.
Angesichts der vielbeschworenen demographischen Bedrohung der sozialen Sicherungssysteme wird dem Leser Gelassenheit angeraten. Dazu argumentiert Wildner mit Produktivitätssteigerungen, erhöhtem Renteneintrittsalter und gesünderem Altern. Viel wichtiger sei es, die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Blick zu nehmen, etwa Frauenerwerbstätigkeit zu fördern. Im Gesundheitsbereich sieht er Chancen durch Prävention im Alter, Integrierte Versorgung und Disease Management, Telemedizin und Pflegequalität.
Angesichts der vielbeschworenen demographischen Bedrohung der sozialen Sicherungssysteme wird dem Leser Gelassenheit angeraten. Dazu argumentiert Wildner mit Produktivitätssteigerungen, erhöhtem Renteneintrittsalter und gesünderem Altern. Viel wichtiger sei es, die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Blick zu nehmen, etwa Frauenerwerbstätigkeit zu fördern. Im Gesundheitsbereich sieht er Chancen durch Prävention im Alter, Integrierte Versorgung und Disease Management, Telemedizin und Pflegequalität.
In „Der Weg zum ewigen Leben“ geht es um die erwähnte Steigerung der Lebenserwartung. Betrachtet man die Durchschnittswerte näher, ergeben sich beachtliche Differenzen. So liegen zwischen dem sozioökonomisch wohlhabendsten und dem untersten Fünftel der Bevölkerung mehrere Jahre Lebenserwartung. Dennoch steigt diese insgesamt betrachtet weiter – auch wenn, so die Schlusspointe, die Lebenserwartung mit Blick auf das ewige Leben eher sinkt – weil der Glaube auf dem Rückzug ist.
Auch die Vermögensungleichheit in Deutschland wächst, was nach Wildner dazu führt, dass man reich und gleichzeitig arm sein kann, denn Gesundheit, Bildung, Kriminalität und andere Wohlstandsindikatoren verschlechterten sich mit zunehmender Ungleichverteilung des relativen Reichtums für alle, nicht nur für die Armen. Unter Rückgriff auf Lyotard, Weber, Derrida und andere Geistesgrößen fordert der Autor eine neue Kursbestimmung für das Gesundheitswesen. Er beklagt postmoderne Beliebigkeit, die das Gesundheitssystem anfällig für Ausbeutung durch starke Interessengruppen mache. Dabei schüttet er allerdings das (moderne) Kind mit dem (postmodernen) Bade aus und polemisiert: „Bürgerliche Tugenden? Bourgeoisie. Religion? Pharisäertum. Familie? Eine Lebensabschnittsgemeinschaft, wenn überhaupt.“ Um am Ende als Orientierungspunkt für den neuen Kurs nur Tallinn angeben zu können, wo 2008 für die WHO-Region Europa eine Charta verabschiedet wurde, in der es gleich im ersten Punkt der Präambel heißt: „Die Charta von Tallinn bekräftigt die in früheren Chartas, Übereinkommen und Erklärungen vereinbarten Werte und nimmt sie an.“
Wildner schreckt auch über das Gesundheitswesen hinaus vor großen Fragen nicht zurück: „Was ist überhaupt ‚Staat‘, was sind seine Aufgaben, und wie soll er sie wahrnehmen?“ fragt er im Kapitel „Der gute Staat – eine Meisterleistung“. Die Krise der EU lässt den Beitrag zu Europa („Europas heutige Söhne und Töchter scheinen auf Kurs zu liegen“) in seinem Optimismus bestürzend obsolet wirken. Umso wichtiger ist Wildners Hinweis, worin das Zeitgemäße der EU besteht: Sie entspricht der Tendenz „einer zunehmenden Individuation bei gleichzeitig höherer Integration – wie kein anderes Staatengebilde auf der Welt.“ In „Politik als Beruf – Verantwortlichkeit und Augenmaß“ spricht sich Wildner für eine „Evidenz-informierte Gesundheitspolitik“ aus, um einerseits das „beste gegenwärtig verfügbare Wissen“ in politische Entscheidungen einfließen zu lassen, aber andererseits unter Vermeidung technokratischer Sachzwang-Entscheidungen Gestaltungsspielräume nutzen zu können.
Von der wissenschaftlichen Evidenz bis zur politischen Umsetzung müssen mehrere beschwerliche Stufen überwunden werden, wird in „Transfer inklusive – der Weg in die Praxis“ betont. Darüber hinaus kann das Resultat ganz anders aussehen als ursprünglich gedacht. Wildner ruft zu Geduld und Gelassenheit auf: Das Kamel, das vom Komitee in die Welt geschickt wird, sei vielleicht sogar nützlicher als das ursprünglich geplante Pferd. Berufspolitisch weist der Autor darauf hin, dass Jahr für Jahr mehr Ärzte ausgebildet würden; der Arztmangel in bestimmten Regionen sei ein Verteilungsproblem. Es gebe zudem eine hohe Nachfrageelastizität nach ärztlichen Leistungen, die wesentlich vom Preis mitbestimmt werde. Gesundheit sei ein hohes Gut, das im sozialen Kontext zu sehen und individuell zu definieren sei. „Es gibt ein Zuviel“ – als Beispiel nennt Wildner die Enhancement-Medizin, die eine fremdgesteuerte Körperoptimierung betreibe. Der regionalen Ungleichverteilung gegensteuern ließe sich mit Vergütungsanreizen, „Studienplatzquoten für Niederlassungen in ländlichen Bereichen“ oder dem Ausbau von E-Health. Zu fragen sei nicht, wie viele Ärzte gebraucht würden, sondern „wie viele Ärzte wir wo und mit welchen Qualifikationen bereitstellen wollen.“
Wildner wirbt für „eine allgemeine bevölkerungsweite Risikokompetenz“ einschließlich einer Grundgelassenheit im Umgang mit Restrisiken. Seine Überlegungen zu Gesundheitsrisiken münden in die Empfehlung, zum neuen (Lebens-)Jahr nicht mehr Gesundheit zu wünschen, sondern „gesunde und damit geglückte Entscheidungen und (Aus-)Wahlen“. An Beispielen stellt Wildner im Beitrag „Kennen Sie Morgellonen? Erfundene Krankheiten und verleugnete Risiken“ dar, dass Krankheiten ebenso wie deren Verleugnung soziale Konstrukte sein können. Inzwischen sei man schon einen Schritt weiter, indem eine medizinische Versorgungsindustrie entstanden sei, die sich diese Mechanismen zunutze mache.
Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens wird skizziert, um grundlegende Fragen aufzuwerfen: „Wo hat die herkömmliche Ökonomie ihren guten und unverzichtbaren Platz im Gesundheitswesen, wo liegen ihre Grenzen?“ Am Ende des Kapitels „Ein Quantum Trost- ein Thriller um Macht und Geld“ steht allerdings ein beherztes Sowohl-als-auch, das jeder unterschreiben kann. Nach ähnlichem Muster erörtert Wildner die Frage: „Patient, Nutzer, Kunde – wie hätten Sie es gerne?“ Er stellt Homo oeconomicus und Homo patiens gegenüber und kommt zum Schluss, dass man sich der komplexen Realität am ehesten annähern könne, wenn man die jeweils zur Situation passende Rolle einnehme und ansonsten das verbindende Substantiv Homo in den Vordergrund stelle.
Am Beitrag „Sprichwörtliche Weisheit – Prävention ist Investition“ zeigt sich exemplarisch die Missverständlichkeit der Verlagswerbung für das Buch: Eher als dass anhand von Fakten Widersprüche aufgezeigt und mit Irrtümern aufgeräumt würde, werden allgemeine Betrachtungen angestellt, die den Weg zu maßvollen Reformen weisen sollen. In diesem Fall münden sie in die Neuformulierung eines Sprichworts: „Investiere in der Zeit, dann hast Du in der Not!“ Um es Wildner gleichzutun, der gern und häufig rhetorische Fragen stellt: Wer wollte da widersprechen?
Am Beitrag „Sprichwörtliche Weisheit – Prävention ist Investition“ zeigt sich exemplarisch die Missverständlichkeit der Verlagswerbung für das Buch: Eher als dass anhand von Fakten Widersprüche aufgezeigt und mit Irrtümern aufgeräumt würde, werden allgemeine Betrachtungen angestellt, die den Weg zu maßvollen Reformen weisen sollen. In diesem Fall münden sie in die Neuformulierung eines Sprichworts: „Investiere in der Zeit, dann hast Du in der Not!“ Um es Wildner gleichzutun, der gern und häufig rhetorische Fragen stellt: Wer wollte da widersprechen?
Eine Rezension von Martin Braun

