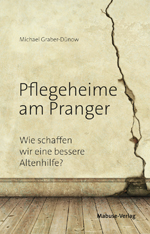
Michael Graber-Dünow
Wie schaffen wir eine bessere Altenhilfe?
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2015, 172 S., ISBN 9783863211790
Wie schaffen wir eine bessere Altenhilfe?
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2015, 172 S., ISBN 9783863211790
Michael Graber-Dünow gibt in seinem Buch einen Überblick über politische, rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen, unter denen Altenhilfe in Deutschland stattfindet. Beginnend bei der Struktur der Altenheime, über das Binnenleben eines Altenheimes, hin zu Ursachen und Wirkungen des Pflegenotstands, sowie den Konsequenzen der Pflegeversicherung. Dem folgend geht der Autor auf dengeltenden Qualitätsbegriff, dieAuswüchse der Bürokratisierung, sowie auf Prüfinstanzen und der Diskussion über die sog. „Pflegenoten“ ein.
Der Anspruch des Autors ist es, aufzuklären und zu sensibilisieren für die Problematiken der Altenhilfe in Deutschland – dies betrifft sowohl Pflegebedürftige selbst, als auch deren Angehörige und Pflegende. Graber-Dünow stellt sich die Frage: Steht die Altenpflege zurecht am medialen Pranger? Als Adressaten des Buches benennt der Autor in der Altenpflege tätige, Auszubildende, Ehrenamtliche, sowie politisch Verantwortliche. Das Buch versteht sich als Plädoyer für eine bessere Altenhilfe.
Der Autor beschreibt Beispiele aus dem Alltag der Altenpflege, die ihm selbst als grotesk (S. 125 ff.) anmuten und gibt Anregungen für Reformvorschläge. Als zentralen Konflikt benennt er den Personalmangel (S. 73 ff., 76 ff.) und das mitunter daraus resultierende schlechte Image des Altenpflegeberufes (85 ff.). Zu hohe Anforderung in Bürokratie (S. 129, 133, 152) und „Pro Kopf“–Arbeitslast (S. 97), als auch eine schleichende Deprofessionalisierung (S. 99) werden weiterhin thematisiert. Trotz teilweise nicht tarifgemäßer Bezahlung, belastender Arbeitszeiten und mitunter schlechter Bedingungen in der Ausbildung (S. 85 ff.), gelte esaber die positiven Aspekte des Berufes hervorzuheben (S. 162). Auch die derzeitige Finanzierung der Pflege kritisiert Graber-Dünow; die Pflegeversicherung solle „in der bestehenden Form gänzlich“ (S. 162) abgeschafft werden. Der Heimalltag hingegen sei von der „totalen Institution“ (S. 145) geprägt und würde nicht den Bedürfnissen und Wünschen der Heimbewohner gerecht (S. 163). Eine Abmilderung dieser Merkmale würde dazu beitragen, dass Altenheime ihren Schrecken verlören (S. 163). Graber-Dünow schlussfolgert, dass zwar einige ´schwarze Schafe´ zurecht am Pranger stünden, vor allem sei es aber die Sozialpolitik, die zur Rechenschaft gezogen werden müsse (S. 164 ff.). Er betont, dass die Pflege der alten Menscheneine „ethisch-moralische Frage“ (S. 157) sei, die die ganze Gesellschaft beträfe (ebd.). So folgt auch ein Appell an die Wissenschaft, Dokumentationssysteme zu entwickeln, „die der Verbesserung der Pflege und Betreuung dienen müssen und [nicht zum] Selbstzweck“ (S. 160) verkommen dürfen.
„Pflegeheime am Pranger“ ist wohl ein bewusst gewählter, provokativer Titel, der sich leider in die gewohnte Polemik – sobald über Missstände in der Altenpflege berichtet wird – einreiht. Die an den Titel angeschlossene Frage „Wie schaffen wir eine bessere Altenhilfe?“ verspricht zumindesteinen lösungsorientierten Ansatz. Im Buch werden Lösungsvorschläge thematisiert, die sich vor allem an politisch Verantwortliche richten. Missstände und deren Konsequenzen für zu Pflegende und Pflegende selbst werden aufgezeigt. Graber-Dünow berichtet über – im Grunde genommen –Altbekanntes. Besonders deutlich wird dies auch in einem Zwischenruf von Claus Fussek ab Seite 109: Fussek bezeichnet die Situation in der Altenhilfe nach einem Zitat von Dieter Hilfebrand als „Realsatire“ (S. 113). Von ihm folgt ein Appell an Pflegende und die Frage: „Vor wem müssen kompetente Pflegekräfte eigentlich Angst haben?“ (S. 116). Die öffentliche Diskussion über die Pflege, an der sich Pflegende selbst– aus den verschiedensten Gründen – nur selten beteiligen kannals Symptom derFremdbestimmung der Pflegeberufe betrachtet werden. Die reine Systemkritik – wie im vorliegenden Buch – wird aber ins Leere laufen, da sie angesichts mehr oder weniger undurchsichtiger politischer und finanzieller Interessenlagen dem Einzelnen kaum Handlungsspielraum aufzeigt. Die Frage „Wie schaffen wir eine bessere Altenhilfe?“ muss somit auch mit berufspolitischen Forderungen beantwortet werden für die sich Pflegende aktiv einsetzen können. Auch Auszubildende werden dabei zu wenig angesprochen. Weder die Notwendigkeit einer Interessenvertretung der Pflegeberufe oder Reformen der Pflegeausbildungen werden thematisiert.
Das vorliegende Buch dient der kritischen Meinungsbildung und berichtetüber die Hintergründe, die oftmals zu genau den traurigen Skandalen führen, die aus den Medien bekannt sind. Für Pflegende selbst kann das Buch ein Anstoß sein, sich mit dem System in dem sie tätig sind, auseinanderzusetzen. Das Buch bietet dabei aber nicht mehr als einen Überblick.
Eine Rezension von Elisabeth Fay

